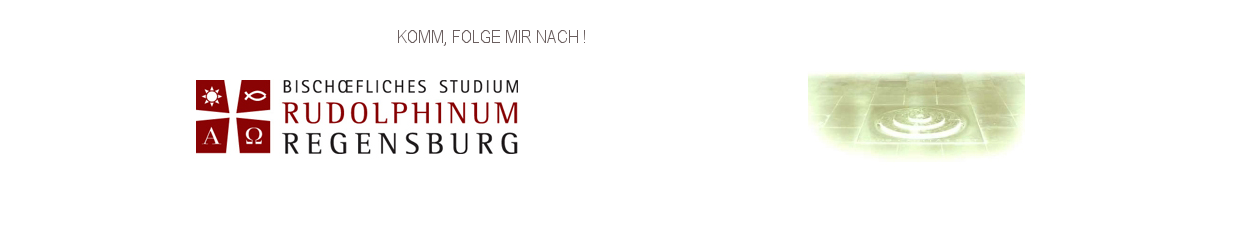Wintersemester 2025/26
(Beginn: 13. Oktober 2025)
Dogmatik
Dozent: Prof. Dr. Christoph Binninger
„Dominus Jesus“
Christologie/ Soteriologie
Die Vorlesung geht zwei Grundfragen nach:
1. Wer ist Jesus von Nazareth?
„Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: «Jesus Christus ist der Herr» – zur Ehre Gottes, des Vaters.“ (Phil 2,6-11)
Im Mittelpunkt der Reflexionen über die Identität Jesu stehen die biblischen Aussagen und die sich daran anschließenden theologiegeschichtlichen Entfaltungen, die zu den christologischen Grunddogmen führen. In einem weiteren Schritt sollen aktuellere Neuansätze im Bereich der Christologie dargelegt werden.
2. Welche Heilsbedeutung kommt dem Wirken Jesu Christi zu?
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Mk 10,45)Im Mittelpunkt der soteriologischen Reflexionen stehen die Fragen nach der Heilsbedeutung der Inkarnation und des österlichen Heilswerkes. (3 SWS)
Literatur:
WAGNER, H., Dogmatik, Stuttgart 2003.
GRILLMEiER, A., Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 1, Freiburg / Br. 21982.
SCHNEIDER, Th. (Hrsg.), Handbuch der Dogmatik, Bd. 1, Düsseldorf 21995.
KKD IV,1.
BEINERT, W. (Hrsg.), Glaubenszugänge. Lehrbuch der Katholischen Dogmatik, Bd. 2, München 1995.
__________________________________________
Patrologie
Dozent: Prof. Dr. Christoph Binninger
Von Augustinus (354-430) bis zum Ende der Spätantike (7./8 Jhdt.)
Die Vorlesung weist zwei Schwerpunkte auf:
1. Augustinus von Hippo. Im Mittelpunkt stehen das Leben, das Wirken und die Werke des nordafrikanischen Kirchenvaters sowie seine bleibende theologiegeschichtliche Bedeutung bis heute.
2. Kirchenväter am Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter
Mit der Völkerwanderung und den damit verbundenen Kriegen, die zum Untergang des weströmischen Reiches führen, kündigt sich schemenhaft eine „neue“ Zeit an, deren Herausforderungen sich auch die Kirchenväter dieser Epoche stellen müssen. (2 SWS)
Literatur:
TRAPÈ, A., Aurelius Augustinus. Ein Lebensbild, übers. v. Brehme, München 1988.
O’DONNELL, J., Augustine, Boston 1985.
Dassmann, e., Augustinus, Heiliger und Kirchenlehrer, Köln 1993.
Drobner, H., Lehrbuch der Patrologie, Freiburg/ Br. 1994.
Friedrowicz, M., Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg/ Br. 2007.
__________________________________________
Liturgiewissenschaft
Dozent: Dr. Sven Boenneke
Fundamentalliturgik
In der Vorlesung sollen die Grundlagen für ein reflektiertes Studium und Verständnis der liturgischen Überlieferung vor allem der römischen Kirche gelegt werden, um auf dieser Basis in den folgenden Semestern insbesondere die Feier der hl. Messe, der Sakramente und des Stundengebetes vertieft zu erschließen. Dafür werden neben Grundlagen und Methoden des Fachs vom Ansatz der Liturgischen Bewegung her Gesetzmäßigkeiten, Theologien und Geschichte der Liturgiefamilien des Westens dargestellt. Dies mündet in eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte, Theologie und einigen Einzelbestimmungen der Liturgiekonstitution des II. Vaticanum.(2 SWS)
Quelle und Kommentare:
II. Vatikanisches Konzil, Konstitution „Sacrosanctum Concilium“, z.B. DH 4001-4048.
BOUYER, L., Erneuerte Liturgie. Geistlicher Kommentar zur Liturgiekonstitution, Salzburg 1965.
Kaczynski, R., Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium: Hünermann, P., Hilberath, J. (Hrsg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg i. B. u.a. 2004, Bd. 2, 11-227.
LENGELING E. J., Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie. Lateinisch-deutscher Text mit einem Kommentar von Emil Joseph Lengeling (Lebendiger Gottesdienst Heft 5/6), Münster 1964.
Literatur:
ADAM, A., HAUNERLAND, W., Grundriss Liturgie, Freiburg i. Br. u.a. 20183.
BAUMSTARK, A., Comparative Liturgy. By Anton Baumstark. Revised by Bernard Botte et al. English Edition by F.L. Cross et al. London, 1958.
BRADSHAW, P. F., The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, London 20022.
GUARDINI, R., Über die systematische Methode in der Liturgiewissenschaft, in: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 1 (1921), 97-108.
DERS. Vom Geist der Liturgie, Freiburg i. B. 1918 (= Werke, Bd. 35, Mainz u.a.1997).
HERWEGEN, I., Die Liturgie als Lebensstil, in: ders., Alte Quellen neuer Kraft. Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf 1920, 63-77.
KLÖCKENER, M., Meßner, R. (Hrsg)., Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 1: Wissenschaft der Liturgie, Bd. 1: Begriff, Geschichte, Konzepte, Regensburg 2022.
MARTIMORT A.-G., Handbuch der Liturgiewissenschaft, 2 Bde., Leipzig 1965.
Meßner, R., Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn, München u.a.2009.
VAGAGGINI, C., Theologie der Liturgie. Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von August Berz, Einsiedeln u.a. 1959.
__________________________________________
Moraltheologie
Dozent: Prof. Dr. Clemens Breuer
Grundlegung der Moraltheologie (I und II) – Gegenstand und Methode der Moraltheologie
Blick in die Geschichte der Moraltheologie
Die Erkenntnisquellen der Moraltheologie: Glaube und Vernunft (Teil I)
Die Frage nach der Bedeutung der Worte „gut“ und „böse“, „gut“ und „schlecht“ gehört zu den ältesten Fragen der Menschheit. Die Frage nach der Sittlichkeit gehört somit unleugbar auch zur Theologie. Die Theologie muss sich deshalb nicht nur um die Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheit bemühen, sondern dem Menschen zugleich auch zeigen, wie er sein Leben nach dem Willen und Plan Gottes gestalten kann bzw. soll. „Die Moral ist jener Teil der Theologie, in dem die Normen des freien menschlichen Handelns im Lichte der Offenbarung erforscht werden.“ (F. Böckle) In der Vorlesung soll eingehend nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Moraltheologie und der Moralphilosophie gefragt werden. Unabdingbar sind im Weiteren Einblicke in die Geschichte der Moraltheologie, die bisweilen auch als „unruhige“ Disziplin bezeichnet wird. Erst vor dem Hintergrund der Geschichte wird erkennbar, in welcher Art und Weise und mit welchen Inhalten moraltheologisches Sprechen und Handeln in unserer Zeit gerechtfertigt ist bzw. unabdingbar erscheint. Dass die beiden Erkenntnisquellen der Moraltheologie, Glaube und Vernunft, hierbei eine entscheidende Gewichtung erhalten müssen, wird eingehend angesprochen. Vieles spricht dafür, in der heutigen Zeit die „Perspektive der Moral“ anhand des Paradigmas einer „Tugendethik“ zu begründen (vgl. M. Rhonheimer, E. Schockenhoff etc.). (3,5 SWS)
Literatur:
Enzyklika „Fides et ratio“ von Johannes Paul II. über das Verhältnis von Glaube und Vernunft (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135), Bonn 1998 (6. Auflage 2008).
BÖCKLE, Franz, Grundbegriffe der Moral. Gewissen und Gewissensbildung, Aschaffenburg 8. Auflage 1977.
BREUER, Clemens (Hg.): Ethik der Tugenden. Menschliche Grundhaltungen als unverzichtbarer Bestandteil moralischen Handelns, St. Ottilien 2000.
PIEGSA, Joachim, Der Mensch – das moralische Lebewesen. Fundamentale Fragen der Moraltheologie, St. Ottilien 1996.
RATZINGER, Joseph, Kirchliches Lehramt – Glaube – Moral, in: Ders., Prinzipien Christlicher Moral, Einsiedeln 1975, S. 41-66.
RHONHEIMER, Martin, Die Perspektive der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethik, Berlin 2001.
SCHOCKENHOFF, Eberhard, Naturrecht und Menschenwürde. Universalistische Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz 1996.
SCHOCKENHOFF, Eberhard, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, Freiburg/Br. 2007.
SPAEMANN, Robert, Moralische Grundbegriffe, München, unveränderte 8. Auflage 2009 (1. Auflage 1982).
__________________________________________
Kirchenrecht
Dozent: Prof. Dr. Yves Kingata
Kirchliches Verfassungsrecht I
Von der Systematik des Codex Iuris Canonici her bietet die Vorlesung einen Abriss der zentralen Rechtsinstitute und Regelungen des Verfassungsrechts der katholischen Kirche. Dabei wird der Fokus auf die Gläubigen und ihre Rechtsstellung in der Kirche gelegt. (2 SWS)
Literatur
AYMANS, W., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici. Begründet von Eduard Eichmann, fortgeführt von Klaus Mörsdorf, neu bearbeitet von Winfried Aymans, 13., völlig neu bearb. Aufl., Bd. I-IV, Paderborn u.a. 1991/1997/2007/2015.
DE WALL, H., / MUCKEL, S., Kirchenrecht. Ein Studienbuch, 5. Aufl. überarb., München 2017.
HAERING, S./ REES, W. / SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl. grundlegend neubearb., Regensburg 2015.
LORETAN, A./ TOLLKUEHN, M., Nichtchristen in den kirchlichen Rechtsordnungen. Eine kritische Konzilsrezeption, in: Letizia Bianchi/ Gabriela Einsering u.a. (Hg.), Fides et jus in ecclesia. Scritti in onore di Augusto Cattaneo, Siena 2023.
LUEDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Essen seit 1985 (Loseblattwerk; Stand des Gesamtwerks: 61. Lfg., Februar 2022) (mit periodisch aktualisiertem Quellen- und Literaturverzeichnis).
MUELLER, L. / OHLY, C., Katholisches Kirchenrecht: ein Studienbuch, 2. Aufl., Paderborn 2022.
RHODE, U., Kirchenrecht, Stuttgart 2015.
Rechtliche Ordnung des Verkündigungsdienstes
Die Vorlesung bietet einen Überblick über die Grundfragen des kirchlichen Verkündigungsdienstes der katholischen Kirche. Konkret setzt sie sich mit den kodikarischen Normen über Religionsfreiheit und Glaubenspflicht, Formen der Glaubensverkündigung sowie der katholischen Erziehung und Bildung auseinander. Zuletzt wird der Akzent auf die Förderung und den Schutz der Glaubens- und Sittenlehre gelegt. (2 SWS)
Literatur
AYMANS, W., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici. Begründet von Eduard Eichmann, fortgeführt von Klaus Mörsdorf, neu bearbeitet von Winfried Aymans, 13., völlig neu bearb. Aufl., Bd. I-IV, Paderborn u.a. 1991/1997/2007/2015.
DE WALL, H., / MUCKEL, S., Kirchenrecht. Ein Studienbuch, 5. Aufl. überarb., München 2017.
HAERING S. / REES W. / SCHMITZ, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl. grundlegend neubearb., Regensburg 2015.
LUEDICKE, K. (Hg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Essen seit 1985 (Loseblattwerk; Stand des Gesamtwerks: 61. Lfg., Februar 2022) (mit periodisch aktualisiertem Quellen- und Literaturverzeichnis).
MUELLER, L./ OHLY, C., Katholisches Kirchenrecht: ein Studienbuch, 2. Aufl., Paderborn 2022.
RHODE, U., Kirchenrecht, Stuttgart 2015.
__________________________________________
Pastoraltheologie
Dozent: Prof. Dr. Veit Neumann
Einzelseelsorge und Krise – Konkrete Anforderungen an Seelsorger
Mitverursacht durch sozialen Wandel begegnen dem Seelsorger gegenläufige Tendenzen in kirchlicher Praxis und an kirchlichen Orten von Gemeinschaft (Pfarrei). Vielgestaltige Lebensentwürfe und Glaubenswege sind ein Indiz für die zunehmende Heterogenität auch unter gläubigen Menschen. Die Vorlesung problematisiert die Ausrichtung von Seelsorgekonzepten an Zielgruppen in einer Zeit der Kirche in der Krise. Sie überlegt, welche kommunikativen Kompetenzen in dieser Situation einer neuen Unübersichtlichkeit Vermittlung und Verkündigung ermöglichen. Theologisch gefragt wird, welche praktischen und welche geistlichen Voraussetzungen erforderlich sind, um im pastoralen Alltag zu bestehen. (2 SWS)
Literatur:
EBERTZ, M. N., Keine Freude, keine Hoffnung? Diakonia 46 (2015) 3, S. 174-180.
HELLGERMANN, A., In der Falle der Individualisierung, Katechetische Blätter 138 (2013) 4, S. 288-292.
INFUEHR, H., Lebendigere Gemeinden durch Aktivierung von Zielgruppen. Der Beitrag der Aktionsforschung zur Gemeindebildung, Diakonia 2 (1981) 1, S. 22-39.
MERK, R. Zauberwort Zielgruppe, Diakonie 1999, 6, S. 10.
__________________________________________
NT-Exegese
Dozent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann
Die Passions- und Ostererzählungen der vier Evangelien
Das Bekenntnis, dass Jesus Christus „für unsere Sünden starb, begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist“, gehört zu den Grundaussagen christlichen Glaubens (vgl. 1 Kor 15,3-5 u.ö.). Zugleich liegt in der Tatsache, dass der Gottessohn weder einen ehrbaren noch den Heldentod starb, sondern ausgerechnet die mors turpissima crucis erlitt, eine große Herausforderung für die Verkündigung wie die Reflexion der frühen Kirche.
In den Passions- und Ostererzählungen der vier kanonischen Evangelien wird dieses Geschehen in narrativer Form entfaltet. Diese Erzählungen sind „kein historisches Protokoll, sondern von Anfang an gedeutetes Geschehen“ (B. Janowski). Die Deutung des Schicksals Jesu erfolgt im Horizont der religiösen Erfahrungen Israels, nicht zuletzt der Klagepsalmen und der sog. Gottesknechtslieder. Kreuzestod und Auferstehung Jesu erfolgte ja „gemäß den Schriften“, wie Paulus in 1 Kor 15,3-5 sagt. Nur so konnte die Urkirche sprachlich fassen, was an sich unfassbar war. Die vier Passionserzählungen stehen wiederum in einem komplexen literarischen Verhältnis zueinander und gehen auf ältere Vorlagen zurück, die vermutlich im Kontext der frühen (juden-)christlichen Pesachfeiern entstanden sind. Dass sie auch historisch auswertbare Informationen über Jesu Prozess und Hinrichtung sowie deren Auslöser enthalten, ist dabei unbestritten.
In der Vorlesung werden die neutestamentlichen Passions- und Ostererzählungen ausgelegt, ihre unterschiedlichen theologischen Akzentsetzungen werden herausgearbeitet, aber auch historische Fragestellungen behandelt. (2 SWS)
Literatur (Auswahl – neben den Kommentaren zu den Evangelien):
Becker, J., Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testament. Ostererfahrung und Osterverständnis im Urchristentum, Tübingen 1997.
Chapman, D.W., Ancient Jewish and Christian Perceptions of Crucifixion (WUNT II/244), Tübingen 2014.
Egger, P., „Crucifixus sub Pontio Pilato“. Das „Crimen“ Jesu von Nazareth im Spannungsfeld römischer und jüdischer Verwaltungs- und Rechtsstrukturen (NtA NF 32), Münster 1997.
Frey, J. (Hg.), Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament (UTB 2953), Tübingen 2007.
Gielen, M., Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische Schwerpunkte, Stuttgart 2008.
Niemand, C., Jesus und sein Weg zum Kreuz. Ein historisch-rekonstruktives und theologisches Modellbild, Stuttgart 2007.
Paulus, C. G., Der Prozess Jesu – aus römisch-rechtlicher Perspektive (Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin Heft 194), Berlin/Boston 2016.
Samuelsson, G., Crucifixion in Antiquity. An Inquiry into the Background and Significance of the New Testament Terminology of Crucifixion (WUNT II/310), Tübingen 2011.
Theobald, M., Der Prozess Jesu. Geschichte und Theologie der Passionserzählungen (WUNT 489), Tübingen 2022.
__________________________________________
Griechische Lektüre zur Vorlesung (fakultativ)
Dozent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann
In der Lektüre werden zentrale Texte aus dem Stoff der Vorlesung gemeinsam übersetzt und theologisch vertieft. (2 SWS)