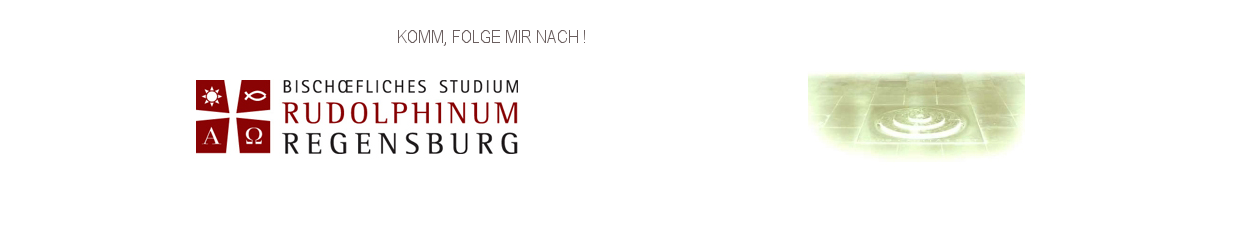Sommersemester 2024
(Beginn: 15. April 2024)
Dogmatik
Dozent: Prof. Dr. Christoph Binninger
Sakramentenlehre II
Um das Werk des Heils zu verwirklichen, „ist Christus seiner Kirche immerdar gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen… Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramts Christi; durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt…“ (SC 7) Die Sakramente Christi vermitteln somit den Menschen das Heil: die Gemeinschaft mit Gott und allen Erlösten.
Die Vorlesung stellt die Heilsbedeutung der Sakramente Ordo und Krankensalbung dar.
(2 SWS)
Literatur:
HDG IV 1a und HDG IV 1b.
KASPER, W., Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz 1976.
MUßNER, F., Der Jakobusbrief, Freiburg/Br. 19752.
RATZINGER, J., Opfer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche, in: Catholica 26 (1972) 108-125.
KKD VII.
MÜLLER, G.L., Katholische Dogmatik, Freiburg/Br. 19983, 628-768.
Grundzüge einer katholischen Eschatologie
Jeden Tag gehen wir unserem eigenen Tod entgegen. Er kommt – unausweichlich. Was aber dürfen wir hoffen? Die Frage nach einem Leben nach dem Tod wird bei vielen Menschen ausgeklammert oder mit Hilfe synkretistischer Elemente beantwortet. Was aber lehrt die katholische Kirche über das Leben nach dem Tode? Was bedeuten „Tod“, „Fegfeuer“, „Himmel“ und „Hölle“, „Auferstehung der Toten“, „Jüngstes Gericht“ usw.?
(2 SWS)
Literatur:
RATZINGER, J. Eschatologie. Tod und ewiges Leben, Regensburg 19782.
MÜLLER, G. L., Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis, Freiburg/Br. 19983, 516 – 579.
Handbuch der Dogmengeschichte IV, 7a – d.
SCHLIER, H., Das Ende der Zeit, Freiburg/Br. 1971.
_____________________________
Dogmatik (Seminar)
Dozent: Prof. Dr. Christoph Binninger
„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ (Lk 1,28) –
Grundfragen der Mariologie
Das II. Vatikanische Konzil hebt sowohl in seinem Dekret über den Dienst und das Leben der Priester („Presbyterorum ordinis“, 18) als auch in seiner Dogmatischen Konstitution über die Kirche („Lumen Gentium“, 52-69) die Bedeutung Mariens in der Heilsgeschichte und damit auch im Leben der Kirche hervor. Aus diesem Grund beschäftigt sich das Seminar mit den dogmatischen Grundfragen der Mariologie.
(2 SWS)
Literatur:
Balthasar, H. U., von, „Du krönst das Jahr mit deiner Huld.“, Einsiedeln 1982.
Müller, G. L., Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg/ Br. ²1998.
Rahner, H. Maria und die Kirche, Innsbruck ²1962.
Rahner, K. Grundkurs des Glaubens, Freiburg/ Br. 1975.
Ratzinger, J., Die Tochter Zion, Einsiedeln ³1978.
Ratzinger, J., Einführung in das Christentum, München 41968.
Scheeben, M. J., Handbuch der katholischen Dogmatik, Bd. 2, Freiburg/ Br. 1878; Bd. 3, Freiburg/ Br. 1882.
Scheffczyk, L., Maria. Experiment des katholischen Glaubens, in: ders., Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977, 306-323.
Scheffczyk, L., Der systematische Ort der Mariologie heute: ThGl 68 (1978) 408-425.
Ziegenhaus, A., Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie, in: Katholische Dogmatik, Bd. 5, Aachen 1998.
_____________________________
Liturgiewissenschaft
Dozent: Dr. Sven Boenneke
Liturgiewissenschaften IV. Sakramente und Kasualien
„Die Wirkung der Liturgie der Sakramente und Sakramentalien ist also diese: Wenn die Gläubigen recht bereitet sind, wird ihnen nahezu jedes Ereignis ihres Lebens geheiligt durch die göttliche Gnade, die ausströmt vom Pascha-Mysterium des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi.“ (SC 61). Die Vorlesung zielt auf eine entsprechende Feier der Sakramente, die dafür liturgiepastoral erschlossen werden. Die heutigen Formen von Taufe, Firmung, Beichte, Krankensalbung, Ehe, Weihen und Beerdigung werden dafür anhand der Hauptetappen ihrer jeweiligen historischen Entwicklung dargestellt und liturgiehistorisch eingeordnet.
(2 SWS)
Literatur:
ADAM, A., HAUNERLAND, W., Grundriss Liturgie, Breiburg i.Br. 112018.
BUGNINI, A., Die Liturgiereform. 1948-1975. Zeugnis und Testament. Freiburg i.Br. 1988.
CHUPUNGCO, A. (Hg.), Sacraments and Sacramentals: Handbook for Liturgical Studies IV, Collegeville 2000.
KLEINHEYER, B., Sakramentliche Feiern I: Gottesdienst der Kirche. Handbuch für Liturgiewissen-schaft 7/1, Regensburg 1989.
DERS., v. SEVERUS, E., KACZYNSKI, R., Sakramentliche Feiern II: Gottesdienst der Kirche 8, Regensburg 1984.
MESSNER, R., Einführung in die Liturgiewissenschaft, Paderborn, München u.a. 2009.
MESSNER, R., KACZYNSKI, R., Sakramentliche Feiern I,2: Gottesdienst in der Kirche. Handbuch für Liturgiewissenschaft 7/2; Regensburg 1992.
_____________________________
Moraltheologie
Dozent: Prof. Dr. Clemens Breuer
Grundlegung der Moraltheologie
Das Gewissen in Freiheit und Bindung ; Wahrheit und Lüge
Für die Grundlegung jeglichen moralischen Denkens, Sprechens und Handelns spielt das Gewissen eine entscheidende Rolle. „Das Gewissen ist die Gegenwart eines absoluten Gesichtspunktes in einem endlichen Wesen; die Verankerung dieses Gesichtspunktes in seiner emotionalen Struktur.“ (R. Spaemann) Seiner langen Tradition zufolge ist die Rede vom Gewissen jedoch weithin mit einer rätselhaften und umstrittenen Aussprache verbunden. Eingehend wird die Lehre bekannter katholischer Persönlichkeiten (Augustinus, Thomas von Aquin, John H. Newman etc.) zum Gewissen vorgetragen. Daneben werden verschiedene Stimmen zu Wort kommen, die sich von den christlichen Auffassungen über das Gewissen unterscheiden.
Die Ächtung der Lüge scheint ein vielen Kulturen verbreitet zu sein. Dennoch ist es eine weit verbreitete Auffassung unter Naturwissenschaftlern, dass nicht die Wahrheit, sondern die Lüge am Anfang der Naturgeschichte des menschlichen Verhaltens stehe. Das Wahrheitsverständnis der Moraltheologie wird angesprochen und anhand von konkreten Fragestellungen erläutert.
(3,5 SWS)
Literatur:
Enzyklika „Fides et ratio“ von Johannes Paul II. über das Verhältnis von Glaube und Vernunft (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135), Bonn 1998 (6. Auflage 2008).
BÖCKLE, F., Grundbegriffe der Moral. Gewissen und Gewissensbildung, Aschaffenburg 8. Auflage 1977.
PIEGSA, J. Der Mensch – das moralische Lebewesen. Fundamentale Fragen der Moraltheologie, St. Ottilien 1996, S. 310-406.
RHONHEIMER, M., Die Perspektive der Moral. Philosophische Grundlagen der Tugendethik, Berlin 2001.
SCHOCKENHOFF, E., Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, Freiburg/Br. 2007.
SCHOCKENHOFF, E., Zur Lüge verdammt? Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft und die Ethik der Wahrheit, Freiburg/Br. 2000.
SILL, B., Phänomen Gewissen. Gedanken, die zu denken geben. Ein Textbuch, Hildesheim 1994.
SPAEMANN, R., Moralische Grundbegriffe, München, unveränderte 8. Auflage 2009 (1. Auflage 1982).
_____________________________
AT-Exegese
Dozent: Prof. Dr. Oliver Dyma
Die Schöpfung
Zu den Basiskategorien theologischen Nachdenkens gehört die Vorstellung der Schöpfung. Wir verstehen die Welt als Schöpfung, uns selbst als Geschöpfe, als aus dem Schöpferwillen Gottes entsprungen. Die beiden Schöpfungstexte der Genesis gehören zu den bekanntesten Texten des Alten Testaments überhaupt, da sie in der Liturgie, im Unterricht, aber auch in der künstlerischen Rezeption ihren Platz haben. Aussagen über Gott als Schöpfer und seine Schöpfung finden sich aber auch in anderen, oft unbekannten Texten: In den Ijob-Dialogen wird die Unbegreiflichkeit der Schöpfung thematisiert, Deuterojesaja formuliert die monotheistische Spitzenaussage „Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel, ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil.“ (Jes 45,7)
Die Welt als Schöpfung zu verstehen heißt daher auch zu fragen, wie das Verhältnis Gottes zu dieser Schöpfung ist, zu fragen, woher das Unheil in der Welt kommt, aber auch darüber nachzudenken, wie der Mensch in seinem Verhältnis zu Gott und zur Welt gesehen wird. Die Autoren der Priesterschrift haben dafür die nachhaltig wirksame Vorstellung der Gottebenbildlichkeit entwickelt.
Das Alte Testament hat Konzeptionen aus seiner Umwelt aufgegriffen und verarbeitet. Wir werden verschiedene biblische Texte mit ihrer jeweiligen Schöpfungstheologie kennen lernen und, um diese besser zu verstehen, uns mit den Mythen und Bildern der altorientalischen Umwelt auseinandersetzen.
Gerade bei den Schöpfungstexten wird die Hermeneutik biblischer Texte besonders deutlich (Stichworte: Kreationismus, sog. Neuer Atheismus). Wir beschäftigen uns daher auch mit solchen Fragen: Wie können wir diese Texte heute noch verstehen, wie ist ihr Verhältnis zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen?
(3 SWS)
Literatur:
SCHMID, K. (Hg.), Schöpfung (Themen der Theologie 4; utb 3514), Tübingen 2012.
KEEL, O., SCHROER, S., Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext altorientalischer Religionen, Göttingen – Freiburg/CH 2002 (2. Auflage 2008).
Themenheft „Schöpfung – Gabe und Aufgabe“: Bibel und Kirche 60 (2005), Heft 1.
JEREMIAS, J., Theologie des Alten Testaments, GAT/ATD.E 6, Göttingen 2015.
JANOWSKI, B., Tempel und Schöpfung. Schöpfungstheologische Aspekte der priesterlichen Heiligtumskonzeption, in: ders., Gottes Gegenwart in Israel, Neukirchen-Vluyn 1993, 214–246.
SMITH, M.S., The Priestly Vision of Genesis 1, Minneapolis 2010.
BOORER, S., The Vision of the Priestly Narrative. Its Genre and Hermeneutics of Time, Ancient Israel and its Literature 27, Atlanta 2016.
GUILLAUME, Ph., Land and Calendar. The Priestly Document from Genesis 1 to Joshua 18, LHBOT 391, New York 2009.
BLUM, E., Noch einmal: Das literargeschichtliche Profil der P-Überlieferung, in: F. Hartenstein/K.
SCHMID (Hg.), Abschied von der Priesterschrift? Zum Stand der Pentateuchdebatte, VWGTh 40, Leipzig 2015, 32–64.
LEVIN, CH., Die Priesterschrift als Quelle. Eine Erinnerung, in: ebd., 9–31.
_____________________________
Kirchenrecht
Dozent: Prof. Dr. Yves Kingata
Kirchliches Eherecht
Die Vorlesung „Eherecht II“ ist eine Fortsetzung der bereits im Wintersemester 2023/2024 begonnene Vorlesung „Eherecht I“. Nach den allgemeinen Einführungen zu den Voraussetzungen zur katholischen Eheschließung und den Ehehindernissen wird der Akzent auf Konsensmängel, Eheschließungsform, Ehevorbereitung, Trauungsverbote, Gültigmachung sowie Auflösung von Ehen gesetzt.
(3 SWS)
Literatur:
AYMANS, W., kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici. Begründet von Eduard Eichmann, fortgeführt von Klaus Mörsdorf, neu bearbeitet von Winfried Aymans, 13., völlig neu bearb. Aufl., Bd. I-IV, Paderborn u.a. 1991/1997/2007/2015.
PREE, H., Kirchenrecht: allgemeine Normen und Eherecht, Wien 1983.
ZAPP, H., kanonischs Eherecht, Freiburg 1988.
HAERING, S., Rees, W., Schmitz, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl. grundlegend neubearb., Regensburg 2015.
LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Essen seit 1985 (Loseblattwerk; Stand des Gesamtwerks: 61. Lfg., Februar 2022) (mit periodisch aktualisiertem Quellen- und Literaturverzeichnis).
_____________________________
Homiletik
Dozent: Dr. Werner Schrüfer
„Gegenwärtig ist er in seinem Wort“ (SC 7) Homiletik – Theologische und praktische Einführung in das Geschehen christlicher Verkündigung
Die Vorlesung setzt sich das Ziel, Theorie und Praxis christlicher Verkündigung einer grundlegenden theologischen Bestandsaufnahme zu unterziehen, wobei der Begriff „Verkündigung“ die ganze Bandbreite öffentlicher und geistlicher Redesituationen beinhaltet. Zugleich wird von jedem Teilnehmer erwartet, eine Ansprache zu erarbeiten und vorzutragen sowie sich diesbezüglich einer (internen) Analyse zu stellen.
Zur Vorbereitung und Grundlegung wird das aufmerksame Erleben von Situationen öffentlicher Rede und konzentriertes Hören sonntäglicher Predigten empfohlen.
(3 SWS)
Literatur:
ZERFAß, R., Grundkurs Predigt, Bde. I und II, Düsseldorf 1987 und 1992.
ROTH, U., SCHÖTTLER, H.-G., ULRICH, G. (Hg.), Sonntäglich. Zugänge zum Verständnis von Sonntag, Sonntagskultur und Sonntagspredigt (= Ökumenische Studien zur Predigt 4), München 2003.
THIELE M., Geistliche Beredsamkeit. Reflexionen zur Predigtkunst, Stuttgart 2004.
ENGEMANN, W., LÜTZE Frank M. (Hg.), Grundfragen der Predigt. Ein Studienbuch, Leipzig22009.// auch als eBook erhältlich.
VOGT, F., Predigen als Erlebnis. Narrative Verkündigung. Eine Homiletik für das 21. Jahrhundert, Neukirchen-Vluyn 2009.
Apostolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM des Heiligen Vaters Papst Franziskus (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr. 194).
WOLLBOLD, A., Predigen. Grundlagen und praktische Anleitung, Regensburg 2017.
_____________________________
Religionspädagogik
Dozentin: Dr. Annemarie Piller
Religionspädagogik II:
Theorien und Methodenkonzepte zwischen Schulunterricht und Katechese
Kommentar: Das Fach Religionspädagogik ist als Teilfach des Bereichs der praktischen Theologie neben seiner Ausrichtung auf die Religionslehrerausbildung auch verpflichtend für das Studium im Rahmen der Priesterausbildung, sofern auch hier der Religionsunterricht bzw. die Religionslehre – traditionell eng verwandt mit der klassischen Katechese – über die Schule hinaus einen eigenen Stellenwert innehat. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die Religionspädagogik schon auf fachwissenschaftlicher Ebene interdisziplinär ausgelegt, mit den Schwerpunkten Theologie, Psychologie und Pädagogik, was für das Theologiestudium z.T. die fächerübergreifende Einblicknahme in andere Wissenschaften erfordert.
Die Vermittlung des Fachs Religionspädagogik im Rahmen des Studium Rudolphinum ist demzufolge zweigliedrig, verteilt auf zwei Semester mit je einer Vorlesung zu je zwei Wochenstunden: a) als Grundlegung/Einführung, b) als Aufbau- bzw. Vertiefung.
Das bedeutet für das SS 2018 unter dem Titel Religionspädagogik II die vertiefende Behandlung religionspädagogischer Kernbereiche mit den Schwerpunkten religionspädagogische und -didaktische Standardtheorien und Methodenkonzepte („Grundlagen für den Schulunterricht“); pfarr- und diözesanzentrierte Katechese („Jugendarbeit und Jugendpastoral; Erwachsenenbildung“ – d.h. in der Praxis: Kommunion- u. Firmvorbereitung, Ministrantenarbeit, Tauf- u. Ehevorbereitung sowie christliche resp. katholische Bildungsarbeit).
(2 SWS)
Literatur:
HILGER, G., LEIMGRUBER S., ZIEBERTZ H.-G., Religionsdidaktik: Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf/ Unter Mitarbeit von Matthias Bahr, Stefan Heil et al. Neuausgabe, vollst. überarb. 6. Aufl. (1. Aufl. 2001) München: Kösel-Verl. 2010. [Standardwerk Kathol. Theol.].
ADAM, G., LACHMANN, R., ROTHGANGEL M. (Hrsg.), Religionspädagogisches Kompendium: Grundlegung u. Kontexte ethischer Urteilsbildung. 8. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2014. [Standardwerk Evang. Theol.].
Die entsprechenden Verlautbarungen der Deutschen Bischöfe ab der Würzburger Synode von 1974.
Lexikon für Theologie und Kirche: Stichworte „Erwachsenenbildung“, „Gemeindekatechese“. [LthK]. Bd. 4, Freiburg i. Br.; Basel etc. : Herder, 1995.
_____________________________
NT-Exegese
Dozent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann
Der Galaterbrief
Der leidenschaftliche und polemische Brief des Apostels Paulus an Gemeinden von Galatien ist das große Dokument der „Freiheit vom Gesetz“ (Gal 5,13), zu der uns Christus durch seinen Fluchtod am Kreuz befreit (3,13), so dass wir „in Christus“ nun „neue Schöpfung“ sind (6,15). Gerade dieser Brief hat wie kein anderer in der Kirchengeschichte zu produktiven Spannungen und massiven Verwerfungen geführt. Die Erarbeitung der hier von Paulus argumentativ entfalteten „Wahrheit des Evangeliums“ und die Rückbindung an ihre historische Situation gehören daher zu den Kernaufgaben der wissenschaftlichen Exegese.
Charakteristisch für den Galaterbrief ist die unlösbare Verbindung von Person („Apostolat“) und Sache („Evangelium“). Deswegen antwortet Paulus auf die Bestreitung seines Apostelamtes und seines Evangeliums mit einer ausführlichen autobiographischen narratio (1,13–2,21), die wertvolle Informationen über Selbstverständnis, Berufung und die frühen Jahre des Apostels bereithält. Sie mündet in eine grundlegende Formulierung seiner (später so genannten) Rechtfertigungslehre (2,16), deren eigentliches Zentrum – das „Sein in Christus“ (2,19f.) – in den Auseinandersetzungen der späteren Jahrhunderte oft in den Hintergrund geriet. Ihr entspricht die am Ende des Briefes eigenhändig nachgetragene weitere Summarium (6,11–18). Zwischen diesen beiden Eckpfeilern entfaltet Paulus eine großangelegte argumentatio (3,1–5,12): Das Vorhaben der von Paulus zum Glauben an Christus geführten Galater, sich durch die Übernahme der Beschneidung in den Abrahamsbund und damit in das Volk Israel zu integrieren, fordert den Apostel zu grundlegenden Überlegungen zum Verhältnis von Christusglauben, Abrahamsverheißung und mosaischem Gesetz heraus. Ihnen stellt er in einem paränetischen Teil (5,13–6,10) grundlegende Weisungen zur praktischen Lebensgestaltung an die Seite.
Allerdings ist der Galaterbrief nicht „das letzte Wort“ des Apostels zu den hier verhandelten Fragen. Nur kurze Zeit später schreibt Paulus den Römerbrief, in dem er einige in den Auseinandersetzungen des Galaterbriefes gewonnene Einsichten nochmals anders formuliert oder neu beleuchtet. Vor allem im Hinblick auf die Zukunft Israels kommen im Römerbrief nochmals eigene Akzente hinzu. Wir werden daher an manchen Stellen der Vorlesung Schneisen vom Galater- zum Römerbrief (und wieder zurück) schlagen und damit einen möglichst breiten Zugang zur Theologie des Apostels erarbeiten.
(2 SWS)
Literatur:
1. Kommentare zum Galaterbrief (Auswahl)
BECKER, J. u.a., Die Briefe an die Galater, Epheser und Kolosser (NTD 8,1), Göttingen 1998.
ECKEY, W., Der Galaterbrief, Neukirchen-Vluyn 2010.
KLAIBER, W., Der Galaterbrief, Neukirchener Theologie 2013.
LUEHRMANN, D., Der Brief an die Galater (ZBK.NT 7); Zürich 21988.
MEISER, M., Der Brief des Paulus an die Galater (ThHKNT), Leipzig 2022.
MEISER, M., Galater (Novum Testamentum Patristicum) 9, Göttingen 2007.
MUSSNER, F., Der Galaterbrief (HThKNT 9), Freiburg 51988.
SCHLIER, H., Der Brief an die Galater (KEK 7), Göttingen 51971.
VOUGA, F., An die Galater (HNT 10), Tübingen 1998.
2. Weitere Literatur zur Einführung
FREY, J., Galaterbrief, in: O. Wischmeyer / E.-M. Becker (Hg.), Paulus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe, Tübingen (3. Auflage 2021, 369–396.
SAENGER, D., Galaterbrief (2016), in: WiBiLex Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet.
THEOBALD, M. Der Galaterbrief, in: M. Ebner/S. Schreiber (Hg.), Einleitung in das Neue Testament, Stuttgart 2008, 347–364.
WOLTER, M., Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, Neukirchen-Vluyn 2011.
_____________________________
Griechische Lektüre zur Vorlesung (fakultativ)
Dozent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann
In der Lektüre werden zentrale Texte aus den Paulusbriefen gemeinsam aus dem Griechischen übersetzt und theologisch vertieft. Außerdem werden sprachliche und theologische Probleme besprochen.
(2 SWS)
Literatur:
NESTLE, ALAND, Novum Testamentum Graece, 28. Auflage, Stuttgart.